
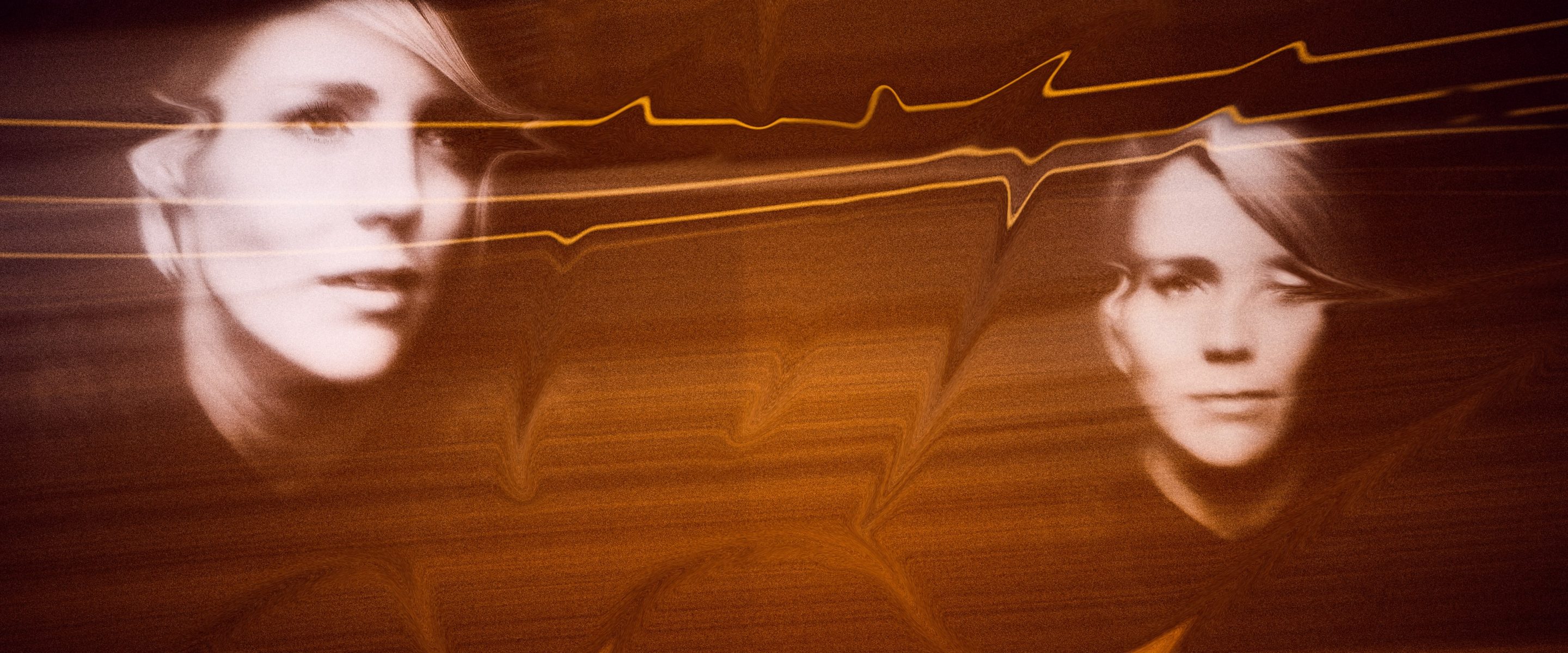
Es gibt keine wirksamen Therapien gegen Depression
Falsch. Es gibt verschiedene Therapien und Behandlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
Depression und Suizidalität sind weit verbreitet. Die Forschung – auch in der UPD – generiert hierzu immer neuere Befunde für alle Altersstufen.
Es gibt wirkungsvolle Therapien wie beispielsweise Psychotherapie und Antidepressiva, die auf unterschiedliche Art wirken und oft in Kombination die beste Wirkung erzielen. Daneben gibt es eine Reihe von unterstützenden Behandlungsmöglichkeiten (Körpertherapien, Kunst- und Musiktherapie u. a.). Neuere Behandlungsmethoden wurden und werden in der UPD erforscht und heute auch klinisch eingesetzt (z. B. transkranielle Magnetstimulation).
Volkskrankheit Depression
Psychische Erkrankungen sind hierzulande noch immer ein grosses Tabuthema. Das gilt insbesondere für die Volkskrankheit Depression. Kein Wunder, ranken sich um dieses Thema unzählige Mythen, Gerüchte und Halbwahrheiten.
Daniela Krneta ist Mitarbeiterin in der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (PP) der UPD. Sie und Psychologe Werner Fey haben ein Quiz entwickelt, um Vorurteile und Tabus zu den Themen Psychiatrie und Depression aufzudecken.
Teste dein Wissen. Die Aussagen beziehen sich auf erwachsene Personen.
1. Was ist die «Waldau»?
Der Name «Waldau» stammt vom ersten Direktor Albrecht Tribolet (1855–1859) und ist eine Wortschöpfung, denn eigentlich heisst das Areal der heutigen UPD «Breitfeld». Doch warum dieser Fantasiename? Tribolet wollte anlässlich der Eröffnung der «Irren-, Heil- und Pflegeanstalt» seiner Institution einen eingängigen, «geruhsamen» Namen geben. Das ist ihm so gut gelungen, dass sich der Name «Waldau» bis heute im Volksmund festgesetzt hat. Leider, muss man aus heutiger Sicht sagen, denn der Begriff «Waldau» ist stigmatisierend und wird häufig mit der lebenslangen Unterbringung verbunden. Darum heisst die Psychiatrische Klinik heute nicht mehr so. Der Standort der UPD heisst nun ganz unspektakulär «Bolligenstrasse».
2. Wie lange bleibt ein erwachsener Patient, eine Patientin durchschnittlich stationär in unserer Klinik?
Die Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (PP) ist heute ein Akutspital und keine Anstalt mehr. Die Aufenthaltsdauern sind in den letzten zehn Jahren massiv gesunken. Psychisch kranke Menschen, die nicht allein leben oder nicht in ihre angestammte Lebensumgebung zurückkehren können, treten nach der Akutphase (wenn sie also nicht mehr spitalbedürftig sind) in Wohnheime, Wohngruppen, Familienpflege oder andere Institutionen mit betreuten Wohnangeboten ein. Heute leben die Patientinnen und Patienten nicht mehr in der Klinik, sondern bleiben nur so lange stationär wie unbedingt nötig.
3. Behandeln die UPD mehr Patientinnen und Patienten stationär als ambulant?
Und zwar deutlich. Nur etwa halb so viele Patientinnen und Patienten der UPD müssen stationär behandelt werden. Willst du es genau wissen? Alle aktuellen Zahlen findest du im Geschäftsbericht auf der Website der UPD.
4. Welche Medikamente machen abhängig? (mehrere Antworten sind möglich)
Entgegen landläufigen Meinungen machen nur die Benzodiazepine abhängig, nicht aber Antidepressiva oder Neuroleptika. Benzodiazepine sind Beruhigungsmittel, die bei ausgeprägten Schlafproblemen eingesetzt werden.
5. Durch welche Berufsgruppe werden die meisten Patientinnen und Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung gesehen?
«Gemäss Wittchen et al. (2011) kommt in der EU nur eine von zwei Personen mit einer psychischen Störung überhaupt in Kontakt mit einer psychotherapeutischen Fachperson. Bei den meisten von diesen beschränkt sich die Unterstützung auf eine allgemeinmedizinische Behandlung. Nur etwa ein Viertel der Personen mit einer psychischen Störung erhält professionelle, auf psychische Erkrankungen ausgerichtete Hilfe. Die Behandlungsrate variiert mit der Art der psychischen Störung.» Laut dem «Monitoring Psychische Gesundheit 2012» wurden 2010 jedoch insgesamt 61,5 % der psychiatrischen Diagnosen in ambulanten Arztpraxen von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gestellt, 38,5% von andern Ärztinnen und Ärzten. Das heisst also, dass Hausärztinnen und Hausärzte am meisten Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung sehen, während Psychiaterinnen und Psychiater die meisten Menschen behandeln, die eine diagnostizierte psychische Erkrankung aufweisen. (Schuler, D. & Burla, L. (2012). Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2012 (Obsan Bericht 52). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, S. 40)
6. Wie viel Prozent der 515 Menschen, die versucht hatten, sich von der «Golden Gate»-Brücke zu stürzen und so das Leben zu nehmen, aber davon abgehalten worden waren, haben sich innerhalb der darauffolgenden 26 Jahren suizidiert? (Seiden et al. 1979)
Es waren unter 5 Prozent, die sich später doch noch das Leben genommen hatten. Die übrigen 95 Prozent (489 Menschen!) wurden also dauerhaft gerettet. Das bedeutet, wenn man Menschen davon abhalten kann, sich das Leben zu nehmen, hat man sehr gute Chancen, ihnen dauerhaft das Leben zu retten. Deshalb lohnt es sich, die Verfügbarkeit der Mittel für einen Suizid zu verringern (z. B. durch Brückensicherungen, Waffen und Munition nicht nach Hause mitzugeben). Es wird immer wieder behauptet, dass die Menschen dann einfach auf ein anderes Mittel ausweichen würden, wenn ihre Methode nicht mehr verfügbar ist. Diese Behauptung ist nur zu einem kleinen Teil richtig. Die Mehrheit der suizidalen Menschen werden NICHT ein anderes Mittel einsetzen.
7. Wie viel Prozent aller Menschen, die in der Schweiz leben, leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer depressiven Erkrankung (Lebenszeitprävalenz in der Schweiz)?
Depressive Störungen sind ungleich über soziodemografische Merkmale verteilt. Besonders auffällig sind die Geschlechterunterschiede, wobei sich bei Frauen eine fast doppelt so hohe Prävalenz depressiver Erkrankungen zeigt wie bei Männern. Die Lebenszeitprävalenz einer «Major Depressive Disorder» liegt für Frauen bei rund 21 Prozent und bei Männern bei 13 Prozent. Dieser Unterschied zeigt sich in Untersuchungen konstant in nahezu allen demografischen Gruppen und über verschiedene Kulturen hinweg (Übersicht in Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Die Lebenszeitprävalenz der Schweizer Bevölkerung für eine unipolare Depression beträgt 16,6 Prozent, während diejenige für alle affektiven Störungen zusammen bei 20,8 Prozent liegt. (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium OBSAN, Bericht 56, Depressionen in der Schweizer Bevölkerung, 2013.)
8. Welche dieser Aussagen zur Depression sind unwahr? (mehrere Antworten sind möglich)
Unwahr: Frauen sind gleich häufig betroffen wie Männer
Frauen sind ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer. Ob dies jedoch tatsächlich so ist, ist nicht eindeutig geklärt. Frauen holen sich häufiger Hilfe und nehmen diese eher an als Männer. Zudem können die Symptome unterschiedlich sein, was mit Geschlechterrollen zusammenhängen kann.
Unwahr: Wer einmal eine Depression erlebt hat, wird immer wieder depressiv werden
Es gibt Menschen, die nur ein einziges Mal in ihrem Leben eine depressive Episode erleben.
Unwahr: Es gibt keine wirksamen Therapien gegen Depression
Es gibt durchaus sehr wirkungsvolle Therapien wie beispielsweise Psychotherapie und Antidepressiva, die auf unterschiedliche Art wirken und oft in Kombination die beste Wirkung erzielen. Daneben gibt es eine Reihe von unterstützenden Behandlungsmöglichkeiten (Körpertherapien, Kunst- und Musiktherapie u. a.). Neuere Behandlungsmethoden wurden und werden in der UPD erforscht und heute auch klinisch eingesetzt (z. B. transkranielle Magnetstimulation).



